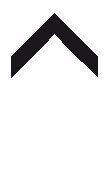Rede zur Vernissage „Wesen(t)liches“
Villa Sponte am 15.9.2024
von Christine Holzner-Rabe
Künstlerinnen: Susanne Schossig und Sabine Harton
Liebe Künstlerinnen, liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde,
von heute an bis zum 13. Oktober zeigen Susanne Schossig und Sabine Harton eine Auswahl ihrer Werke, die das Kuratorinnen-Team in einen Dialog zueinander setzte. Den Titel „Wesen(t)liches“ haben die beiden Künstlerinnen gemeinsam gefunden, denn beiden geht es um das Wesen des Menschseins und beide suchen und erarbeiten in langen Prozessen das Wesentliche im Menschseins. Susanne Schossig und Sabine Harton gehen dabei durchaus ähnliche, aber dennoch völlig unterschiedliche Wege: beide Künstlerinnen zeichnen und malen, inszenieren auch Raum-Installationen und nutzen das breite Spektrum, das ihnen die moderne Kunst an Techniken, Materialien und Inspirationen anbietet; beide arbeiten somit in der Fläche und im Raum.
Hier, in dieser Ausstellung, in beiden Räumen sowie im Flur, sehen wir Werke von Susanne Schossig, die abstrakt gegenstandslos zweidimensional angelegt sind, Sabine Hartons Arbeiten hingegen sind mit einer Ausnahme konkret gegenständlich dreidimensional. Die Ausstellungsliste beider Künstlerinnen ist lang und international, beide zeigten ihre Werke regional, in verschiedenen deutschen und europäischen Städten sowie in den USA und Kanada.
Für die Bremerin Susanne Schossig ist die Zeit die Inspirationsquelle. Sie arbeitet in der Zeit mit der Zeit und verbraucht Zeit. Doch wie stellt man diese Zeit dar? Wie kann dieser abstrakte Begriff „Zeit“ konkretisiert werden, sichtbar gemacht werden? Wie würden wir auf die Aufforderung reagieren, die Zeit zu definieren und sie darzustellen? Wir würden wahrscheinlich zuerst auf die Uhr schauen. In der Fassade des Bremer Rathauses schuf vor über 400 Jahren Lüder von Bentheim ein Bildnis der Zeit: Er modellierte eine Frauengestalt und legte ihr eine Peitsche und eine Sanduhr mit einem Sporn, mit dem der Reiter sein Pferd antreiben konnte, in die Hände. Die Menschen, die damals lebten, konnten diese Allegorie vermutlich verstehen, heute schafft das so gut wie niemand mehr. Susanne Schossig findet eine ganz persönliche künstlerische Ausdrucksform und dazu gehört, dass sie sich Zeit nimmt, sehr viel Zeit. Sie ist bereit, sich mittels Meditation, die sie in einem japanischen Zen-Kloster erlernt hat, in der Zeit zu verlieren. Ihre Art „Leinwand“ sind Sand, Karton sowie Transparentpapier, wie wir es vom technischen Zeichnen kennen, mal kleinformatig im 50 cm-Bereich, aber es sprengt auch das Einmetermaß.
Susanne Schossig
erfindet unentwegt kleinste Zeichen und Formen, die sie in der Wiederholung leicht variiert, und verstreut sie gezielt über das ganze Format in einer eigenwilligen Ordnung, bis ihre Zeit verbraucht ist. Aber nach einer gewissen Zeit, das können Stunden, Tage, Monate und sogar Jahre sein, vertieft sich die Künstlerin immer wieder erneut meditativ in die begonnene Zeichenwelt und legt die nächste Zeichenschicht aus neuen Formen und Farben, aufgetragen oftmals mit anderem Werkzeug, darüber - Schicht für Schicht - bis das Format gefüllt ist, oder die Zeit verbraucht ist. Schließlich steht ein verdichtetes Gefüge vor unseren Augen, das aus schier unendlichen, weder zählbaren noch messbaren winzigen Einzelformen zusammengefügt ist in einem individuellen Ordnungssystem, das jedes Chaos konsequent verbannt. Und dennoch gibt es in den Bildern auch Zufälligkeiten, das kann ein Farbspritzer oder ein Farbklecks sein, die eigenwillig im Werk Platz verlangen – die Künstlerin lässt sie zu, baut sie ein, denn spielerische Elemente gehören auch in das Konstrukt.
Betrachtet man die Zeichnungen konzentriert, so kann man sich ganz leicht vorstellen, wie zeitintensiv der Schaffensprozess verlief. Susanne Schossigs Werke sind fein und zart, transparent und leicht, sensibel und grazil, locker und dicht, manchmal glänzend und manchmal stumpf - und höchst ästhetisch. Sie benutzt Werkzeuge und Materialien wie Bleistift, Buntstift, Feder, Acryl, schwarze und weiße Tusche, die an sich bereits zart und zurückhaltend sind, und besonders in den großen Formaten kommt deren Unaufdringlichkeit geradezu rührend zur Geltung. Susanne Schossigs Bilder sind völlig entkoppelt vom Gegenstand und somit gegenstandslos. Für den Betrachter ist das durchaus schwierig. Denn unser Gehirn fragt immer: was soll das sein, es sucht geradezu süchtig das Gegenständliche; ja, wir tun uns schwer mit der Gegenstandslosigkeit; Aber die Zeit ist kein Gegenstand, obwohl wir sie haben oder auch nicht, obwohl wir sie uns nehmen oder sie vergeuden. Dabei ist die Zeit unendlich. Diese Unendlichkeit sieht Susanne Schossig im quadratischen Maß ihrer Bilder symbolisiert.
Sabine Harton
ist gebürtige Marbacherin und ist, wenn ich es richtig gelesen habe, zum dritten Mal mit einer Ausstellung in Bremen zu Gast. Hinter mir sehen Sie drei recht freundliche Gesichter, von denen jedes aus zwei verschiedenen Frauenbildnissen zusammengesetzt ist. Man merkt das nicht sofort, denn wir wissen, dass unsere Gesichtshälften nicht spiegelbildlich symmetrisch sind. Erst bei eingehender Betrachtung stellt man fest, dass da etwas nicht stimmt, aber man kann es nicht so leicht herausfinden. Sabine Hartons Gesichter werden durchkreuzt von dunklen Strahlen oder Stäben, sind mit Flecken und merkwürdigen Rinnsalen überzogen und wir wissen nicht, was passiert ist. Unsere eigene Erfahrungs- und Erklärungswelt wird angefragt. Die Verfremdung von Gesichtern und ganzen Körpern provoziert Überlegungen: Bin ich das? Wer bin ich? Wie viele Gesichter hat der Mensch? Was drückt sich in der Mimik aus? Wie wirke ich auf Andere? Wir stellen uns oft diese Fragen bezüglich unserer eigenen Person, und bezüglich unserer Mitmenschen.
Mitten im Raum breitet sich eine überdimensionierte, menschenähnliche Figur aus. Genäht aus 12 weißen Herrenhemden schwebt sie mit ausladenden, offenen Armen und es scheint, als wollten sie nach uns greifen und uns einfangen. Die Arme und die Finger haben sich schon verselbstständigt und sind an der Wand festgerahmt. Die Riesenfigur ist eine Adaption an die griechisch-antike mythologische Gestalt der Sirene, wir kennen sie von Homers „Irrfahrt des Odysseus“ aus dem 8. Jahrhundert v. u. Zr.. Er ließ sich von seinen Kameraden an den Schiffsmast binden, um nicht dem betörenden Sirenen-Gesang zu erliegen und folglich sein Leben zu verlieren. Aber er wollte den Gesang hören und wäre ohne das Festhalten seiner Kameraden verloren. Sabine Harton nähert sich mit ihrer Kunst dem Phänomen der Verführung an. Auch die modernen Sirenen locken uns permanent in neue Welten, Konsum und Internet. Können und wollen wir, so wie Odysseus, dem standhalten, uns entziehen?
Auch im nächsten Raum begegnen uns Sirenen. Im Jahr 2021 erhielten fünf Künstler und Künstlerinnen im Rahmen des einjährigen „Rabenprojekts“ in Göttingen jeweils 20 identische Rabenkörper aus Kunststoff und sollten mit ihnen arbeiten. Sabine Harton entfernte die Vogelköpfe und ersetzte sie durch menschlich anmutende Köpfe. So entstanden Mischwesen aus Mensch und Tier, auch hier offenbart sich die Künstlerin als Antikenkennerin, und von deren Mythen inspiriert. Sirenen waren Mischwesen aus Mensch und Vogel, manchmal männlich und manchmal weiblich und durchaus bösartig. Sabine Hartons Menschenköpfe sind aus Ton, den sie mit Latex gemischt und eingefärbt, modelliert und gegossen hat. Erneut stellt sich die Frage nach dem Wesen und der Identität des Menschen. Was ist der Mensch?
Dabei sind Raben durchaus ambivalent besetzt. Gelten sie einerseits als hochintelligent, sie planen ihre Handlungen und sind äußerst einfallsreich bei der Nahrungsbeschaffung – so wie der Mensch. In Märchen und Sagen andererseits begleiten sie Götter ebenso wie Hexen und Zauberer und kündigen deren Erscheinen samt Vorhaben an. Böse Jungs werden sogar in Sieben Raben verwandelt und nur durch die Selbstlosigkeit ihrer kleinen Schwester aus dem Rabenkörper befreit und wieder zu richtigen Menschen. Der Unglücksrabe ist sprichwörtlich und als Galgenvogel frisst er von den Gehenkten. Schauen Sie auch in den Flur! Die schwarze Farbe des Federkleides assoziierte man schnell mit Unheil und Unheimlichem, sowie dem Schwarz der Nacht, in der man nicht richtig sehen kann. Rabeneltern gelten als unzuverlässig und lieblos. Aber die Gesichter der Rabenmenschen sind freundlich, geradezu kindlich harmlos – und so brauchen wir uns nicht zu fürchten. Sabine Hartons „Raben“ vereinigen in sich Mensch und Tier, denn beide sind sich ähnlich. Dabei wissen wir nicht, ob sich die Raben gerade in Menschen verwandeln oder die Menschen sich zu Raben häuten oder ob nicht Mutanten entstanden sind.
In einem Nest liegen individuelle weiße Eier-Gesichter. Das Licht suggeriert Wärme, bald ist die Brut beendet und Etwas kann das schützende Nest verlassen. Aber was für Wesen werden das sein? Was wird hier ausgebrütet? Etwas Menschliches, Menschenartiges sicherlich. Wir wissen es nicht. Diese Geschöpfe werden aber auf keinen Fall gewöhnlich sein – im Guten wie im Gefährlichen - und ob man sie akzeptieren und sich an sie gewöhnen kann, will oder muss, sei dahingestellt.
Immer wieder überrascht und begeistert die Villa Sponte mit eindrucksvollen Ausstellungen, ungewöhnlichen Präsentationen, sensiblen Arrangements und zum Nachdenken anregenden Werkschauen.