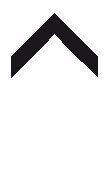Sigrid Schade
Aufschub von Sinngebung
Über die Schwierigkeit, ungegenständlich zu zeichnen
Der Blick auf die Bilder von Susanne Schossig ruft
Kategorien kunsthistorischer Einordnung auf, mit
denen die Generation nach 1945 aufgewachsen ist,
und die fast zu Synonymen für die westliche
„Moderne“ geworden sind, nämlich „Abstraktion“
und „Gegenstandslosigkeit“.1 Abstrakt sind die
sogenannten Sandbilder (Sand und Pigment auf Leinwand)
wie auch die auf transparentem Material gearbeiteten
farbigen und schwarz-weißen Zeichnungen.
Obwohl die Abstraktion ein in der Kunstgeschichte
des 20. Jahrhunderts und der Nachkriegszeit kanonisiertes
Verfahren darstellt, also scheinbar keiner
Legitimation mehr bedarf, muss man feststellen, dass
die kunsthistorischen Deutungsmuster nach wie
vor unbefriedigend sind, die die Selbstbegründungen
z. B. von Wassily Kandinsky und Kasimir Malewitsch
immerzu wiederholt haben.2 Wir können (nach der
deutschen Wiedervereinigung) jenseits der Verknüpfung
der Abstraktion mit politischen Systemen (mit den westlichen Demokratien) neu über ihre Errungenschaften
nachdenken und ihr subversives Potential,
das in den Deutungen der Kunstgeschichte geradezu
verschüttet ist, noch einmal ausleuchten. Dafür,
dass es nach wie vor ein subversives Potential gibt,
spricht vor allem die Tatsache, dass zeitgenössische
Künstler*innen wie Susanne Schossig sich damit
auseinandersetzen und sich mit ihren Arbeiten eher
auf Paul Cézanne, Claude Monet und Barnett Newman
beziehen lassen als auf Kandinsky oder Malewitsch.3
Wenn man die Errungenschaften der Abstraktion
noch einmal ohne die in der Kunstgeschichte übliche
Mythisierung des „Geistigen in der Kunst“ auflistet,
kann man folgende Charakteristika festhalten: Die
Autonomisierung der Bildmittel, die Entkoppelung von
Bild und abgebildetem Gegenstand, bzw. die Thematisierung
der Materialität und Medialität von Malerei,
Zeichnung und anderen Gattungen.
Diese Charakteristika erzeugen vor allem einen
Effekt, der sich beim Betrachten einstellt: Das Anhalten
oder der Aufschub der automatischen Verknüpfung
von Vorstellungsbildern mit Begriffen in unseren alltäglich
ablaufenden Wahrnehmungsprozessen. Anders
formuliert: ein Aufhalten der Sinngebung, die unsere
Wahrnehmung so zwanghaft wie unbewusst begleitet.
Subjekte sehen sich selbst immer im Zentrum ihrer
eigenen Wahrnehmung. Von allem, was wir sehen, was
zu sehen gegeben ist, glauben wir, dass es uns zu
sehen gegeben ist und von uns gedeutet werden will,
so als habe sich die ganze Welt für uns entworfen.
Dieser unendliche, unstillbare, nicht aufzuhaltende
Wille zur Deutung in Bezug auf uns selbst, der das
Subjekt zu ihrem Zentrum macht, wird von ungegenständlichen
Bildern angehalten und – wenn vielleicht
auch nur für einen Moment – aufgeschoben. Damit
werden auch wir als Subjekte für einen Moment aufgeschoben,
angehalten und aus der Mitte unserer
Wahrnehmung herauskatapultiert. Für wen – so fragen
wir uns – ist etwas gemacht, das nicht an unser
Verstehen appelliert und unsere Deutung nicht ohne
Umstände zulässt? Sind wir es überhaupt, die deuten?
Wiederholen wir nicht Deutungen, die uns durch
Erziehung, Erinnerung, Konsens etc. nahelegt werden?
Eine Frage, die kaum zu ertragen ist. Wir halten das
Anhalten und den Aufschub nicht aus, und deshalb
können wir mit dem Interpretieren nicht aufhören.
Susanne Schossig sagt von ihren Bildern, dass
sie „still sein“ sollen, meditativ. Es sollen Bilder sein,
die der alltäglichen Geschwätzigkeit keinen weiteren
Lärm hinzufügen, die es ermöglichen innezuhalten,
die Alltagsgeschäfte – und damit sich selbst – zumindest
zeitweise zu vergessen.
Das Stille-Machen oder anders gesagt: der
Aufschub von Sinn ist gleichfalls etwas, das offenbar
nicht lange auszuhalten ist. Und es ist keinesfalls
leicht, Bilder zu gestalten, die diesen Anspruch erfüllen,
denn dem Zwang des Deutens ist ja nicht erst der
Rezipient ausgesetzt, sondern bereits die Künstlerin.
Sie muss Strategien entwickeln – und zwar in der
formalen Gestaltung – die die Bahnen der Wahrnehmungsmuster
durchkreuzen und entkoppeln. Von
Cézanne wird überliefert, dass er meinte, der Maler
müsse, um zu sehen und zu malen: „vergessen,
Stille machen, ein vollkommenes Echo sein“.4 Das
heißt nichts anderes als: Bedeutungen dessen, was
zu sehen und zu malen ist, vergessen, und das, was
zu sehen und zu malen ist, selbst ins Spiel bringen –
die Materialität und Medialität der Bilder, nämlich
Fläche, Farbe, Pinselstriche etc. Wenn auch die ungegenständliche
Malerei eine Entkoppelung des Bildes
vom abgebildeten Gegenstand eingeführt hat, so hat
sie sich gleichwohl einen anderen Gegenstand gewählt:
ihr eigenes Material.
Offenbar konnten aber auch die Avantgarde-
Künstler das Deutungs-Vakuum, das sie mit ihrer
Malerei erzeugt haben, selbst nicht aushalten, denn
sie produzierten häufig gleich Deutungs-Vorlagen
(Manifeste) mit, an denen sich die Kunstgeschichte
bis heute orientiert. Ihre Legitimations-Schriften
zeugen vom Zwang zur Sinngebung. Sie zeugen auch
vom Erklärungsdruck, dem die Künstler sich ausgesetzt
fanden. Kandinsky führte in seiner Schrift „Über das
Geistige in der Kunst“5 (1911) quasi religiöse Deutungen
ein. Auch Klee und Itten und selbst Malewitsch entwickelten
religiöse, anthroposophische u.a. Kontexte,
in denen diese „Idea“-Konzeption der Kunst weitere
Varianten erfährt und als Überwindung des Materiellen
gefeiert wird.6 Aus dem Aufschub von Sinngebung
wird so eine umstandslose Überführung in einen
„Gesamt-Sinn“, eine metaphysische, holistische Sinnstiftung.
Die Selbstzeugnisse der abstrakten Moderne
haben den Diskurs der Kunstgeschichte, die diese
Meistererzählungen bis heute fortsetzt, immens beeinflusst.
Damit wird verhindert, dass der Gegenstand
ihrer Malerei, nämlich ihre Materialität und Medialität
selbst ins Blickfeld gerät.
Als man in der Nachkriegszeit versuchte, die
im Nationalsozialismus als „entartet“ ausgegrenzte
Moderne zu rehabilitieren, und sich dabei auf die
ungegenständliche Kunst beschränkte, wurden der
Abstraktion weitere Deutungen als unmittelbare
Sinnstiftungen aufgezwungen. Zum einen die, dass es
sich um einen spezifischen Realismus handele, der
z.B. mikroskopische Fotografien von Kleinstrukturen
oder makroskopische Aufnahmen vom Weltall oder
Bilder von Atom-Explosionen spiegele, ein Realismus
also, der sich an der fortgeschrittenen (Kriegs-)
Technologie orientiere. Zum anderen wurde die Abstraktion
gewissermaßen zur Allegorie der Freiheit,
die Zustimmung für sie durch die westdeutsche Kulturpolitik
galt als Zeichen für deren demokratische
Verfasstheit – auch hier ein übertragener Sinn, der
aus einem historischen Kontext abgeleitet wird. Mit
diesen Deutungen wird letztlich eine Verunsicherung
wieder stillgestellt, deren Wirkungen aber weiter
erfahrbar bleiben. Susanne Schossig hat in ihrer künstlerischen
Praxis verschiedene Strategien entwickelt,
in der formalen Gestaltung von Bildern den Deutungswunsch des Betrachters zu durchkreuzen. Diese sind
im künstlerischen Prozess der Herstellung keineswegs
nur an hoch reflektierte, theoretische Entscheidungen
gebunden, sondern können auf der Grundlage von
intuitiven, manchmal auch aus Negationen herausgearbeiteten
Entscheidungen entstehen.
Der Einsatz des Zu-Sehen-Gebens geschieht in
einem Prozess permanenten Ausweichens vor fixierter
oder fixierender Zeichengebung. Und wer es schon
einmal versucht hat, weiß, wie schwierig es ist, dieses
Ausweichen aufrechtzuerhalten. Es ist entgegen
der landläufigen Meinung keineswegs einfach, ungegenständlich
zu arbeiten und konstant ungegenständlich
zu bleiben. Die dadurch entstehende Unsicherheit
überträgt sich auch auf die Vorstellung vom Raum: Es
ist ein unendlicher, bewegter, aber keineswegs kontinuierlicher
Raum, der uns aus den Bildern von Susanne
Schossig entgegenzublicken oder sich zu entziehen
scheint. Ich möchte mit einem Zitat von Merleau-Ponty
aus „Le doute de Cézanne“7 schließen. Es handelt
sich bei Susanne Schossigs Bildern um solche, die wir
so wahrnehmen, wie „die entstehende Ordnung
eines im Erscheinen begriffenen Dinges, das dabei ist,
sich vor unseren Augen zu verdichten.“ Merleau-
Ponty nennt eine solche Wahrnehmung „Perception
primordiale“.
Aus der Rede zur Eröffnung der
Ausstellung in der Galerie Steinbrecher,
Bremen, 1997
Sigrid Schade
Postponed Meaning
About the difficulty of drawing non-representationally
A first glance at Susanne Schossig’s paintings brings to
mind certain categories of art-historical classification
with which the post-1945 generation grew up and which
have become almost synonymous for Western „“modern
art”, namely its “abstract” and “non-representational”
forms.1 Abstract are the so-called sand paintings (sand
and pigment on canvas) as well as the coloured and
black-and-white drawings rendered on transparent
material. Although abstraction represents a process
canonized in the art history of the 20th century and postwar
period, and thus does not seem to require any
further legitimation, it must be noted that the patterns
of interpretation in art history still remain unsatisfactory,
something which was continually iterated in the apologetics
of Wassily Kandinsky and Kazimir Malevich, for
example.2 Now, in the wake of German reunification,
we can rethink its achievements beyond the abstract
link to political systems (i.e. Western democracies) and
once again illuminate the subversive potential which
has been virtually buried in the various interpretations
of art history. That a subversive potential still exists
is seen above all in the fact that such contemporary artists
as Susanne Schossig address this issue and that
their works relate more to Paul Cézanne, Claude Monet
and Barnett Newman than to Kandinsky or Malevich.3
If one were to list once more the achievements of abstraction
without mythicizing the “spiritual in art” that is
common in art history, the following characteristics can
be noted: the autonomation of visual means, the decoupling
of the image from the object depicted, and the
thematization of the materiality and mediality of painting,
drawing and other genres.
These characteristics create, above all, an effect
that arises upon viewing: the suspension or postponement
of the automatic association of conceptual images
with concepts that occupy our everyday perceptual
processes. In other words: putting a stop to the interpretation
that so obsessively as well as unconsciously
accompanies our perception. Subjects always see themselves
at the centre of their own perception. Of all
that we see what is given to see, we believe that it is has
been given to us to see and wants to be interpreted by
us, as if the whole world has been designed for us. This
infinite, insatiable and irrepressible will to interpretation
in relation to ourselves, which makes the subject its
centre, is halted and – if perhaps only for a moment –
postponed by non-representational images. As a
result, we as subjects are also postponed for a moment,
stopped and catapulted from the centre of our perception.
For whom – we ask ourselves – is something made
that does not make an appeal to our understanding
and does not permit our interpretation without further
ado? Is it we who are doing any interpreting at all? Are
we not just repeating interpretations that are suggested
to us by education, memory, consensus, etc. An almost
unbearable question. We cannot bear this stopping and
postponing, and that is why we cannot stop interpreting.
Susanne Schossig says that her paintings
should „be still“, meditative. They should be images that
do not add any further noise to daily chatter, that give
us room to pause, to forget our day-to-day affairs – and
thus ourselves – at least for a while. To be still or, in
other words, to postpone meaning is likewise something
which obviously cannot be endured for very long. And
it is by no means easy to create images which fulfil this
demand, since the onus of interpretation does not lie
on the recipient but of course on the artist. It is she who
has to develop strategies – specifically with respect
to formal composition – that cross and decouple the
trajectories of perceptual patterns. Cézanne once said
that the painter, in order to see and paint, must “forget,
become silent, be a perfect echo”4 This means nothing
more than forgetting the significance of what is to be
seen and painted in order to bring into play what is to be
seen and painted itself: the materiality and mediality
of images, namely surface, colour, brushstrokes, etc. Even
if non-representational painting did indeed introduce a
decoupling of the image from the depicted object, it has
nevertheless chosen a different object: its own material.
But apparently this was something even the
avantgarde artists themselves were not able to abide,
since they were the ones who frequently produced
the interpretative presentations (manifests) as the very
orientation which art history follows to the present
day. The tracts they published for their own legitimation
indicate a compulsion to provide meaning. They also
testify to the pressure which artists felt to explain themselves.
In his tract “Concerning the Spiritual in Art”5
(1911), Kandinsky introduced quasi-religious interpretations.
Klee, Itten and even Malevich developed
religious, anthroposophical and other contexts for
providing this “ideal” concept of art with further
variants that celebrated it as overcoming the material.6
The postponement of interpretation thus becomes
a circumstantial transfer to a “total sense”, a metaphysical,
holistic foundation of meaning. The self-testimonies
of abstract modernism have immensely influenced
the discourse of art history, something which continues
in the master narratives to this day. This prevents the
object of their painting, namely its materiality and mediality
itself, from coming into view.
When attempts were made in the post-war
period to rehabilitate modernism, which had been ostracized
as “degenerate” under National Socialism,
it thereby limited itself to non-representational art, with
further interpretations being imposed on abstraction
as a means of creating meaning directly. For one, there
was a specific realism that reflected, for example,
microscopic photographs of minute structures or macroscopic
images of outer space or pictures of nuclear
explosions, and thus a realism that was oriented to
advanced (war) technology. For another, abstraction
became, in a certain sense, an allegory of freedom; its
approval by the cultural policy of West Germany was
seen as a sign of its democratic constitution, again a
figurative meaning derived from a historical context.
Ultimately, with these interpretations an uncertainty
was again laid to rest, but whose effects can still be
felt today. In her artistic work, Susanne Schossig has
developed various strategies for thwarting the viewer’s
desire to interpret the formal design of her paintings.
In the artistic process of their creation, these are by no
means bound only to highly reflective, theoretical decisions,
but instead can emerge on the basis of intuitive
choices or, at times, choices drawn from negations. The
use of the “to-be-seen” is employed as a procedure to
evade fixed signs or their fixating on a permanent basis.
And anyone who has ever tried this knows how difficult
it is to maintain such an evasion. Contrary to popular
belief, it is by no means easy to work abstractly but remain
non-representational on a constant basis. The resulting
uncertainty is also transported to the concept of space:
It is an infinite, moving, but by no means continuous
space which seems to look out at us from the paintings
of Susanne Schossig, or to elude us. I would like to
close with a quote by Merleau-Ponty from “Le doute de
Cézanne”7. The paintings of Susanne Schossig are those
which we perceive as „the emerging order of a thing in
the process of appearing, about to condense before our
eyes“. Merleau-Ponty referred to such perception as
“perception primordial”.
From the speech at the opening
in the Galerie Steinbrecher,
Bremen, 1997